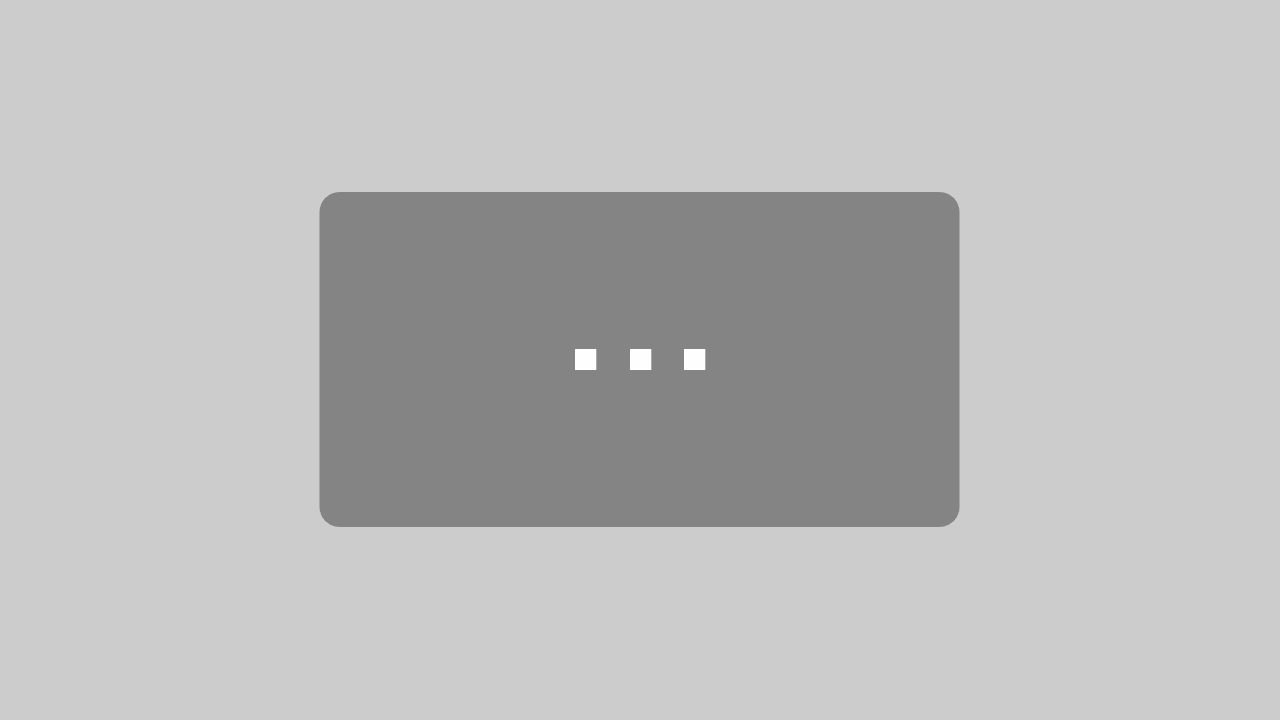Mit dem Tod eines Menschen geht dessen gesamtes Vermögen auch die Schulden auf seine Erben über. Falls die Erben dies nicht wollen, müssen sie das Erbe beim Nachlassgericht in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Kenntnis vom Anfall der Erbschaft ausschlagen. Alles zur Erbfolge und zum Testament – Bestattungsinstitut Welp:
Gesetzliche Erbfolge
Wenn keine anderweitigen Regelungen getroffen worden sind, tritt die gesetzliche Erbfolge gem. §§ 1924 ff. BGB ein. Als gesetzliche Erben berufen sind der Ehegatte und die Verwandten des Verstorbenen. Letztere sind in verschiedene Ordnungen eingeteilt. Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge, d. h. die Kinder, Enkelkinder usw. Erben der zweiten Ordnung sind die Eltern und deren Abkömmlinge. Erben der dritten Ordnung sind die Großeltern und deren Abkömmlinge.
Erbrecht Kinder und Enkel
Es gilt der Grundsatz, dass ein zur Zeit des Erbfalles lebender Abkömmling diejenigen Abkömmlinge von der Erbschaft ausschließt, die durch ihn mit dem Verstorbenen verwandt sind (also seine Kinder und Enkel). Lebt ein Abkömmling nicht mehr, so treten an seine Stelle seine Abkömmlinge. Man nennt das die Erbfolge nach Stämmen. Kinder erben zu gleichen Teilen. Erben der zweiten Ordnung werden erst dann zu Erben berufen, wenn keine Erben der ersten Ordnung vorhanden sind. Für die Erben der dritten Ordnung gilt, dass sie erst dann erben, wenn keine Erben zweiter Ordnung vorhanden sind.
Erbrecht Ehegatte
Als gesetzliche Erben berufen sind der Ehegatte und die Verwandten des Verstorbenen. Letztere sind in verschiedene Ordnungen eingeteilt.
Neben den Erben der ersten Ordnung erbt der Ehegatte ein Viertel. Ein weiteres Viertel erhält er über den Zugewinnausgleich, wenn kein Ehevertrag geschlossen wurde, die Eheleute also im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten. Neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern ist der Ehegatte zur Hälfte als Erbe berufen, auch hier erhält er ein Viertel über den Zugewinnausgleich. Erst wenn weder Verwandte der ersten oder zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden sind, erhält der überlebende Ehegatte die gesamte Erbschaft.

Erbfolge bei Gütertrennung
Bei Gütertrennung entscheidet die Zahl der Kinder. Bei einem oder zwei Kindern erbt der Ehegatte den gleichen Teil wie die Kinder, also die Hälfte oder ein Drittel. Bei mehr als zwei Kindern erbt der Ehegatte ein Viertel, die restlichen Dreiviertel werden zu gleichen Teilen unter den Kindern aufgeteilt.
Das Erbrecht des Ehegatten ist ausgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt des Todes die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Verstorbene die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte.
Testament oder Erbvertrag
Durch ein Testament oder einen Erbvertrag kann man die gesetzliche Erbfolge außer Kraft setzen. So kann beispielsweise der Ehegatte als Alleinerbe eingesetzt werden. Zu beachten ist dabei, dass die Abkömmlinge (Kinder) dadurch enterbt werden und somit ihren Pflichtteil beanspruchen könnten. Der Pflichtteil besteht aus der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.
Testamentsarten
Öffentliches (notarielles) Testament
- von einem Notar verfasst
- mit Beratung
- kann jederzeit auch privatschriftlich geändert werden
Privates (handschriftliches) Testament
- Formvorschriften beachten
- keine inhaltlichen Regeln
Gemeinschaftliches Testament
- Änderungen, Ergänzungen, Aufhebung oder Neufassung nur gemeinsam möglich
Das öffentliche Testament wird von einem Notar aufgesetzt. Er berät in Gesetzesfragen und beurkundet den letzten Willen. Das eigenhändige Testament kann man selbst zu Hause verfassen. Es muss vom ersten bis zum letzten Buchstaben handschriftlich verfasst, datiert und unterschrieben sein. Ist das Testament mit Schreibmaschine oder Computer geschrieben worden, fehlt die Unterschrift oder ist auf ein Aufnahmegerät gesprochen worden, so ist das Testament ungültig – mit der Folge, dass nur die gesetzlichen Erben zum Zuge kommen.
Vorteile und Besonderheiten des eigenhändigen Testaments
Zu Beginn eines Testaments sollte der Verfasser zum Ausdruck bringen, dass er alle vorherigen Testamente widerruft.
Maßgeblich ist der eigene letzte Wille des Erblassers. Es muss nicht angegeben werden, woraus das Vermögen des Erblassers besteht, denn oftmals ändert sich dieses vom Aufsetzen des Testaments bis zum Ableben. Der Vorteil des eigenhändigen Testaments ist, dass man es jederzeit kostenlos durch Nachträge ändern oder auch neu schreiben kann. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass dadurch keine Widersprüche oder Unklarheiten entstehen. Nachträgliche Ergänzungen müssen ebenfalls noch einmal mit Ort und Datum versehen und zusätzlich unterschrieben werden; nur so sind sie rechtsgültig.
Testament schreiben
Was ist beim Schreiben eines Testaments zu beachten?
Zu Beginn eines Testaments sollte der Verfasser zum Ausdruck bringen, dass er alle vorherigen Testamente widerruft. Außerdem muss er bestimmte formelle Anforderungen berücksichtigen. Macht er das nicht, kann das Testament ungültig sein. Zu den strengen formellen Anforderungen des eigenhändigen Testaments gehört: Man darf nicht vergessen, mit Vor- und Zunamen zu unterschreiben, damit kein Irrtum über die Person, die das Testament erstellt hat, aufkommen kann. Zudem ist dringend zu empfehlen, Zeit und Ort der Niederschrift im Testament festzuhalten. Das ist wichtig, weil durch ein neues Testament das alte ganz oder teilweise aufgehoben werden kann. Fehlt auf einem oder sogar auf beiden Testamenten das Datum, weiß man häufig nicht, welches das jüngere und damit gültige Testament ist. Schließlich sollte auch nicht die Überschrift vergessen werden, sie kann „Testament“ oder „Mein letzter Wille“ lauten. Alle Erben müssen im Testament klar erkennbar sein – es sind diejenigen, die im Allgemeinen nicht einzelne Gegenstände, sondern das Vermögen als Ganzes erhalten sollen, bei mehreren Erben jeder einen vom Erblasser bestimmten Bruchteil.
Gemeinschaftliches Testament
Der einseitige Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments muss notariell beurkundet werden.
Was muss beim gemeinschaftlichen Testament beachtet werden?
Bei Eheleuten kommt es häufig vor, dass sie ein gemeinschaftliches Testament verfassen. Im Grunde wird es genauso erstellt wie das Einzeltestament. Der zweite Ehegatte muss lediglich handschriftlich folgenden Satz anfügen: „Dies ist auch mein letzter Wille.“ Dann unterzeichnet er, genauso wie der Ehegatte, der das Testament verfasst hat, mit Vor- und Zunamen, Ort und Datum. Aber: Änderungen, Ergänzungen, eine Aufhebung oder Neufassung können nur beide gemeinsam vornehmen. Möchte nur ein Ehegatte das Testament widerrufen, so kann er das nur mit einer notariell beurkundeten Erklärung. Bei einer Scheidung wird das gemeinschaftliche Testament unwirksam. Nach dem Tod eines Ehegatten wird das vorliegende Testament wirksam.
Ab welchem Alter darf man ein Testament verfassen?
Kein Testament verfassen dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Von 16 bis 18 Jahren darf man bereits Vorsorge für seinen Todesfall treffen, jedoch nur mit einem öffentlichen Testament, d. h., das Testament kann nur bei einem Notar erstellt werden.
Wo bewahrt man ein Testament auf?
Derjenige, der das Testament von jemand anderem besitzt, ist verpflichtet, dieses beim Nachlassgericht abzuliefern, sobald er vom Tod des Verstorbenen erfährt.
Aufbewahren kann man sein Testament, wo man möchte. Legt es der Verfasser jedoch beispielsweise in eine Schublade des Schreibtisches, ohne jemanden darüber zu informieren, besteht die Gefahr, dass das Testament nach dem Tod verloren geht oder vergessen wird. Deshalb empfiehlt es sich, sein Testament in amtliche Verwahrung beim Nachlassgericht zu geben. Das Gericht wird vom Tod des Erblassers benachrichtigt und „eröffnet“ dann den Erben den Inhalt. In diesem Fall sollte der Verfasser eine Person seines Vertrauens darüber informieren, dass er ein Testament gemacht hat und wo dieses zu finden ist.
Testamentseröffnung
Derjenige, der das Testament von jemand anderem besitzt, ist verpflichtet, dieses beim Nachlassgericht abzuliefern, sobald er vom Tod des Verstorbenen erfährt. Das Nachlassgericht eröffnet alle in seiner Verwahrung befindlichen Testamente, sobald es vom Tod Kenntnis erlangt hat.
Ich empfehle Ihnen einen Anwalt für Erbrecht Ihres Vertrauens aufzusuchen, um dementsprechend rechtlich beraten zu werden.
Gerade in der heutigen Zeit finde ich es sehr wichtig seinen letzten Weg mitzugestalten, dementsprechend Vorsorge zu treffen und testamentarisch sein Erbe zu regeln. Somit stellt man sicher das all die Wünsche berücksichtigt werden und keine Streitigkeiten aufkommen können.
Ihre Cornelia Welp